Freundeskreis Paradies e.V. Baden-Baden
Helfen Sie mit, ein wertvolles Denkmal vor dem Verfall zu retten - werden Sie Mitglied
Historie
Die Entwicklung der
Wasserkunstanlage "Paradies"
Pläne zur Einrichtung einer
Parkanlage
auf der Friedrichshöhe gab es seit dem Jahre 1902, nachdem die
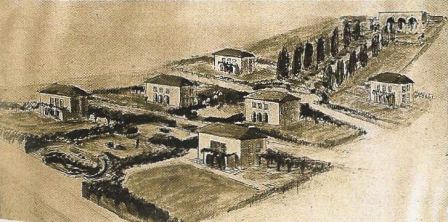 Stadt
das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch
gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.
Stadt
das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch
gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.
Zum 50jährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs Friedrich I.
 regte
Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu
konzipieren.
regte
Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu
konzipieren.
Eine "große Terrasse mit Laubengang und Wasserspiegel" sollte
entstehen, etwas "besonderes und außergewöhnliches" geschaffen werden.
Ein Plan
mit perspektivischer Ansicht wurde erstellt sowie ein Kostenvoranschlag, der ein
Finanzvolumen von 40.000 Mark vorsah. 1910 diskutierte man das Vorhaben erneut;
das Projekt von Richard Riemerschmid sah Kosten von über 54.000 Mark voraus.
Der
Erste Weltkrieg machte alle Pläne zunichte. Bis in die 1920er Jahre blieb das
Areal eine mit Baumgruppen bestandene, von zwei Fahrstraßen und mehreren
Fußwegen durchzogene Wiesenfläche mit schönem Blick zur Rheinebene und auf den
Schwarzwald. Im Dezember 1921 fand eine Geländebesichtigung statt, die
Gestaltung des Parks sollte durch den Verkauf von Bauplätzen finanziert werden.
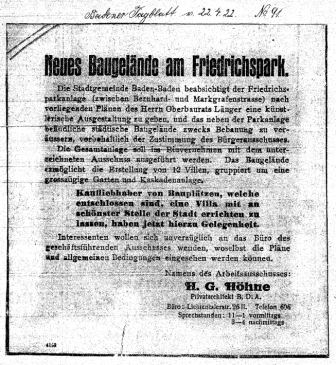 Der
Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im
Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.
Der
Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im
Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.
Die Oberrheinische
Immobilien AG in Freiburg erklärte sich bereit,
 die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die
Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch
einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren
architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf
der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft
schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".
Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.
Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.
die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die
Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch
einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren
architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf
der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft
schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".
Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.
Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.
Für
die Namensgebung hatte sich der Stadtrat bei einer der Einweihung
vorausgegangenen Ortsbesichtigung entschlossen.Die Anlage ist auf die Altstadt mit der
dominierenden Stiftskirche ausgerichtet. Die Achse ist nach dem Vorbild
italienischer Renaissancegärten wie etwa dem der Villa Farnese in Rom als
Wassertreppe ausgebildet. In sanft abfallenden Kaskaden überwindet das Wasser
neben 40 Meter Höhenunterschied auch die Zeppelin- und Prinz-Weimar-Straße.
Am
oberen Ende, an der Markgrafenstraße, beginnen die Wasserspiele in einer großen
Brunnengrotte mit Säulenarkaden und fallen dann über ein größeres Becken mit
Springbrunnen in mehrere kleinere Bassins.
 Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden
Ornamenten
Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden
Ornamenten
 verziert.
Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen
mit Einfassungs-Hecken begleitet.
verziert.
Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen
mit Einfassungs-Hecken begleitet.
Über die Zeppelinstraße hinweg, etwa in der
Mitte der Anlage befindet sich eine Schrifttafel mit dem Gedicht "Der Roemische
Brunnen" von Conrad Ferdinand Meyer - gleichsam das Programm des Paradieses:
"Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale Rund, die sich
verschleiernd überfliesst in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt - sie
wird zu reich - der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich
und stroemt und ruht".
Zwei architektonisch gefasste, als künstliche
Tropfsteinhöhlen angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg
hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen
mit drei Schalen aufgefangen.
angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg
hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen
mit drei Schalen aufgefangen.
Die
Gliederung mit Treppen und Terrassen, die beiderseits der Wasserspiele
hangabwärts verlaufenden Wege, die angrenzenden paarweise und symmetrisch
angeordneten, von Gärten umgebenen Villen im sachlich-schlichten Baustil der
1920 und 1930er Jahre sowie die ausgewogene Bepflanzung mit Hecken, Stauden und
Blumen schaffen das einzigartige Ambiente einer harmonischen Garten- und
Parkarchitektur.
Die bis heute als
Landschaftsgarten unter Denkmalschutz stehende
Wasserkunstanlage war mehrfach in ihrem Bestand gefährdet.
 Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert
Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
 lassen.
lassen.
Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in
der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine
Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den
Mauern.
Die
Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse
eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des
Putzes.
 Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
So ist es kein
Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der
 Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi
Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
1983/84
endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen
erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die
Wasserkaskaden wurden restauriert.
Bis heute bedarf "Das Paradies"
steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie
auch seiner architektonischen Substanz.
 Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter.
Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter.
Das Foto von 1928 zeigt die Familie des
amtlichen Paradieswärters.
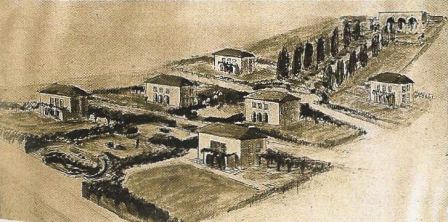 Stadt
das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch
gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.
Stadt
das Grundeigentum des "herrschaftlichen Spitalfonds" erworben hatte. Durch
gezielte Planung sollte dort ein einheitliches Villen- und Parkgebiet entstehen.
Zum 50jährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs Friedrich I.
 regte
Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu
konzipieren.
regte
Bürgermeister Reinhard Fieser an, zu dessen Ehren den Friedrichspark zu
konzipieren. Eine "große Terrasse mit Laubengang und Wasserspiegel" sollte entstehen, etwas "besonderes und außergewöhnliches" geschaffen werden.
Ein Plan mit perspektivischer Ansicht wurde erstellt sowie ein Kostenvoranschlag, der ein Finanzvolumen von 40.000 Mark vorsah. 1910 diskutierte man das Vorhaben erneut; das Projekt von Richard Riemerschmid sah Kosten von über 54.000 Mark voraus.
Der Erste Weltkrieg machte alle Pläne zunichte. Bis in die 1920er Jahre blieb das Areal eine mit Baumgruppen bestandene, von zwei Fahrstraßen und mehreren Fußwegen durchzogene Wiesenfläche mit schönem Blick zur Rheinebene und auf den Schwarzwald. Im Dezember 1921 fand eine Geländebesichtigung statt, die Gestaltung des Parks sollte durch den Verkauf von Bauplätzen finanziert werden.
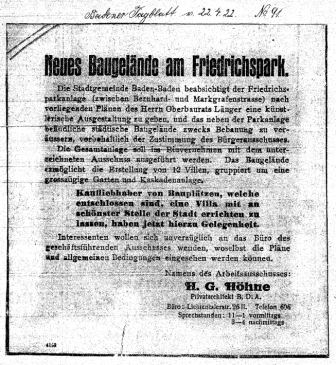 Der
Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im
Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.
Der
Kontakt mit Max Laeuger in Karlsruhe wurde hergestellt, dessen Entwürfe im
Februar 1922 den ungeteilten Beifall des Stadtrates fanden.
Die Oberrheinische Immobilien AG in Freiburg erklärte sich bereit,
 die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die
Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch
einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren
architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf
der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft
schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".
Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.
Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.
die Anlage nach den Plänen Laeugers auszuführen. Als Gegenleistung erhielt die
Gesellschaft das Besitzrecht auf die angrenzenden, in die Anlage architektonisch
einzubeziehenden Bauplätze. Zwölf Villen sollten gebaut werden, deren
architektonische Ausgestaltung genau festgelegt wurde. Max Laeuger wollte auf
der Friedrichshöhe ein Gesamtkunstwerk aus Architektur- und Parklandschaft
schaffen. Zwischen 1922 und 1925 entstand die Garten- und Wohnanlage „Paradies".
Die Einweihung durch Oberbürgermeister Fieser und den Stadtrat fand am 31.
Oktober 1925 statt, die Freigabe für die Öffentlichkeit einen Tag später.
Für die Namensgebung hatte sich der Stadtrat bei einer der Einweihung vorausgegangenen Ortsbesichtigung entschlossen.Die Anlage ist auf die Altstadt mit der dominierenden Stiftskirche ausgerichtet. Die Achse ist nach dem Vorbild italienischer Renaissancegärten wie etwa dem der Villa Farnese in Rom als Wassertreppe ausgebildet. In sanft abfallenden Kaskaden überwindet das Wasser neben 40 Meter Höhenunterschied auch die Zeppelin- und Prinz-Weimar-Straße.
Am oberen Ende, an der Markgrafenstraße, beginnen die Wasserspiele in einer großen Brunnengrotte mit Säulenarkaden und fallen dann über ein größeres Becken mit Springbrunnen in mehrere kleinere Bassins.
 Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden
Ornamenten
Becken und Bassins sind mit stilisierten vegetabilen, in Voluten endenden
Ornamenten
 verziert.
Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen
mit Einfassungs-Hecken begleitet.
verziert.
Beidseitig wird die Wasserkaskade von Säulen-Eichen
mit Einfassungs-Hecken begleitet.
Über die Zeppelinstraße hinweg, etwa in der Mitte der Anlage befindet sich eine Schrifttafel mit dem Gedicht "Der Roemische Brunnen" von Conrad Ferdinand Meyer - gleichsam das Programm des Paradieses: "Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale Rund, die sich verschleiernd überfliesst in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt - sie wird zu reich - der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und stroemt und ruht".
Zwei architektonisch gefasste, als künstliche Tropfsteinhöhlen
 angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg
hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen
mit drei Schalen aufgefangen.
angelegte, sprudelnde Wandbrunnen begleiten den Flaneur auf seinem weiteren Weg
hinab. Das Wasser wird an der Bernhardstraße in einem großen, halbrunden Brunnen
mit drei Schalen aufgefangen.
Die Gliederung mit Treppen und Terrassen, die beiderseits der Wasserspiele hangabwärts verlaufenden Wege, die angrenzenden paarweise und symmetrisch angeordneten, von Gärten umgebenen Villen im sachlich-schlichten Baustil der 1920 und 1930er Jahre sowie die ausgewogene Bepflanzung mit Hecken, Stauden und Blumen schaffen das einzigartige Ambiente einer harmonischen Garten- und Parkarchitektur.
Die bis heute als
Landschaftsgarten unter Denkmalschutz stehende
Wasserkunstanlage war mehrfach in ihrem Bestand gefährdet.
 Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert
Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
 lassen.
lassen.
Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in
der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine
Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den
Mauern.
Die
Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse
eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des
Putzes.
 Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
So ist es kein
Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der
 Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi
Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
1983/84
endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen
erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die
Wasserkaskaden wurden restauriert.
Bis heute bedarf "Das Paradies"
steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie
auch seiner architektonischen Substanz.
 Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter.
Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter.
Das Foto von 1928 zeigt die Familie des
amtlichen Paradieswärters.
 Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert
Aus
finanziellen Gründen konnte Max Laeuger beispielsweise den im 16. Jahrhundert in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
in den Gärten der Villa Farnese verwendeten Tuffstein nicht verarbeiten
 lassen.
lassen.
Brunnen und Kaskaden errichtete man aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr wie in der Gönneranlage in Naturstein, sondern in Stampfbeton mit Vorsatzbeton als Gesteinsimitation; da keine Natursteinoberflächen verwendet wurden, gibt es auch keine Dehnungsfugen in den Mauern.
Die Materialwahl erwies sich im Laufe der Zeit als wenig glücklich. In Risse eindringendes Wasser verursachte große Schäden und zerstörte große Teile des Putzes.
 Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
Mehrfach
mussten die Becken neu abgedichtet werden; auf den Wegen floss das
Oberflächenwasser unkontrolliert und beschädigte sie des öfteren.
So ist es kein Wunder, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ein Abbruch der
 Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi
Anlage
diskutiert wurde; auch erwog man eine Aufgabe der Wasserspiele zugunsten einer
Bepflanzung der Becken. Die vernachlässi gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
gte gärtnerische Pflege der Anlage gab bis in die 1980er Jahre Anlass zur Kritik, so dass zeitweise von einem "Aschenputteldasein"
oder "Dornröschenschlaf" des Paradieses die Rede war.
1983/84 endlich wurde die Anlage unter hohem Kostenaufwand nach alten Plänen erstmals saniert. Bäume wurden gefällt bzw. gestutzt, andere neu gepflanzt, die Beete neu gestaltet. Die Wasserkaskaden wurden restauriert.
Bis heute bedarf "Das Paradies" steter Pflege sowohl hinsichtlich seiner Konzeption als Landschaftsgarten wie auch seiner architektonischen Substanz.
 Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter.
Während der Bauphase
und nach der Fertigstellung der Wasserkunstanlage Paradies nach 1925, beschäftigte die
Stadt Baden-Baden zur Beaufsichtigung und Pflege der Wasserkunstanlage
Paradies eigens einen Wärter. Das Foto von 1928 zeigt die Familie des amtlichen Paradieswärters.